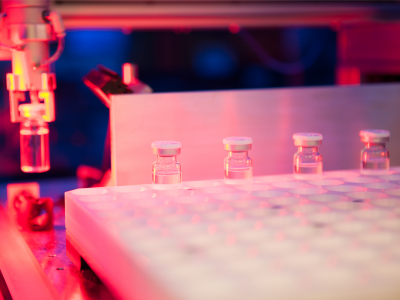Seit Juni 2024 dürfen parenteral verabreichte biotechnologische Arzneimittel – abhängig vom jeweiligen Rabattvertrag – in Apotheken automatisch durch ein anderes, wirkstoffgleiches Präparat ersetzt werden. Diese sogenannte automatische Substitution soll laut Gesetzgeber die Arzneimittelausgaben senken und die Wirtschaftlichkeit des Gesundheitssystems steigern. Für biotechnologische Fertigarzneimittel ist eine entsprechende Regelung ebenso in Planung.
Doch hinter dieser Maßnahme verbirgt sich ein komplexer Eingriff in bewährte Versorgungsabläufe – mit möglichen negativen Folgen für Patient:innen, Ärzt:innen, Apotheker:innen und den Innovationsstandort Deutschland.
Was bedeutet „automatische Substitution“?
Unter automatischer Substitution versteht man den Austausch eines vom Arzt oder der Ärztin verordneten Arzneimittels gegen ein anderes Präparat mit demselben Wirkstoff – ohne erneute ärztliche Entscheidung oder Rücksprache. In der Praxis bedeutet das: Die Apotheke kann ein biotechnologisches Arzneimittel durch ein anderes ersetzen. Es können sowohl biotechnologische Originalpräparate gegeneinander als auch Originalpräparate gegen Biosimilars (biotechnologische Nachahmerprodukte) oder Biosimilars untereinander ausgetauscht werden. Der Patient erhält somit möglicherweise ein anderes Produkt als das, das Arzt oder Ärztin ursprünglich verordnet haben.
Diese Regelung unterscheidet sich deutlich von der bisherigen Praxis bei Biopharmazeutika. Denn biotechnologische Arzneimittel – anders als chemisch-synthetische Medikamente – sind hochkomplex und werden in lebenden Zellen hergestellt. Sie können nicht vollständig identisch reproduziert werden; jedes Produkt weist unvermeidbare Unterschiede in Struktur, Stabilität und/oder Hilfsstoffen auf.
Die möglichen Folgen der automatischen Substitution
Was auf den ersten Blick nach Effizienz und Einsparpotenzial klingt, kann in der Versorgungspraxis erhebliche Risiken bergen:
- Verunsicherung und Vertrauensverlust: Die Sicherheit der Patient:innen hat für uns oberste Priorität. Wenn sie plötzlich ein anderes Präparat erhalten, könnten Zweifel an der Wirksamkeit oder Verträglichkeit aufkommen. Besonders Menschen mit chronischen Erkrankungen, die ihre Medikamente regelmäßig anwenden, reagieren sensibel auf Veränderungen. Unterschiede bei Applikationshilfen, Packungsdesigns oder Schulungsmaterialien erhöhen die Gefahr von Anwendungsfehlern oder Adhärenzverlusten. Zudem werden Ärzt:innen und Apotheken mit zusätzlichen Rückfragen konfrontiert. In manchen Fällen kann es zu Verzögerungen in der Therapie oder zur Notwendigkeit zusätzlicher Schulungen kommen.
- Risiken für Versorgungssicherheit und Wettbewerb: Die automatische Substitution begünstigt die Ausschreibung von exklusiven Rabattverträgen – also Verträge, bei denen nur noch der Arzneimittelhersteller mit dem niedrigsten Preis die Versicherten einer Krankenkasse versorgt. Dies fördert die Marktkonzentration. Wenn nur wenige Anbieter den Markt dominieren, steigt das Risiko von Lieferengpässen – gerade bei biotechnologisch hergestellten Präparaten oder Arzneimitteln. Sie werden häufig gegen schwere Erkrankungen angewendet. Mögliche Lieferengpässe haben hier daher besonders starke negative Auswirkungen.
- Gefährdung des Innovationsstandorts: Der zunehmende Preisdruck kann langfristig dazu führen, dass Forschung, Entwicklung und Produktion von Biopharmazeutika aus Europa abwandern. Heute stammen rund 30 Prozent der für Europa bestimmten Biosimilar-Wirkstoffe aus Deutschland1 – ein Standortvorteil, den es zu schützen gilt.
„Wir brauchen Augenmaß – nicht Automatismus“
„Was auf dem Papier nach effizienter Steuerung klingt, kann in der Realität zu Unsicherheit, Adhärenzproblemen und sogar Versorgungsrisiken führen. Wir brauchen ein Gesundheitssystem mit Augenmaß – nicht Automatismus“, sagt Hatice Camdere, Executive Director Value, Access & Policy bei der Amgen GmbH.
Auch Patient:innenorganisationen wie die BAG Selbsthilfe warnen vor einem unkontrollierten Austausch ohne ärztliche Begleitung. Vertrauen und Therapietreue seien Grundpfeiler erfolgreicher Behandlung – und diese dürften nicht durch rein ökonomische Steuerungsinstrumente gefährdet werden*.
Der Markt funktioniert – Eingriffe sind überflüssig
Der deutsche Biosimilars-Markt gilt als Erfolgsmodell: In vielen Indikationen – etwa in der Onkologie oder bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen – erreichen Biosimilars Marktanteile von bis zu 80 Prozent im ersten Jahr nach Einführung2. Das führt zu jährlichen Einsparungen von rund zwei Milliarden Euro allein im ambulanten Bereich3.
Warum also in ein System eingreifen, das funktioniert? Eine automatische Substitution könnte diese Balance stören – zulasten von Versorgungssicherheit, Wettbewerb und Innovationskraft.
Unser Ziel: Eine Versorgung, die Innovation fördert und gleichzeitig Wirtschaftlichkeit ermöglicht
Amgen ist Experte für biotechnologische Arzneimittel und erforscht, entwickelt und produziert sowohl Originalpräparate als auch Biosimilars. Denn: Gemeinsam tragen sie zu einer innovativen, effizienten und hochwertigen medizinischen Versorgung bei. Während wir mit Originalpräparaten neue innovative Therapien zur Verfügung stellen, haben Biosimilars das Potenzial, den Zugang zu innovativen Therapieansätzen in ausgewählten Bereichen zu erleichtern. Unser Anspruch ist es, Patient:innen bestmöglich zu versorgen – ohne Kompromisse bei der Patient:innensicherheit.
*Positionspapier der BAG Selbsthilfe zum Biosimilars-Austausch in Apotheken, 06.08.2025
Referenzen:
- IW-Köln/HSCI (2023): Produktion von Biosimilars. Wer Reshoring möchte, muss Offshoring vermeiden, S.3
- vfa Biotech-Report: Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2023
- AG ProBiosimilars, Biosimilars in Zahlen 2024